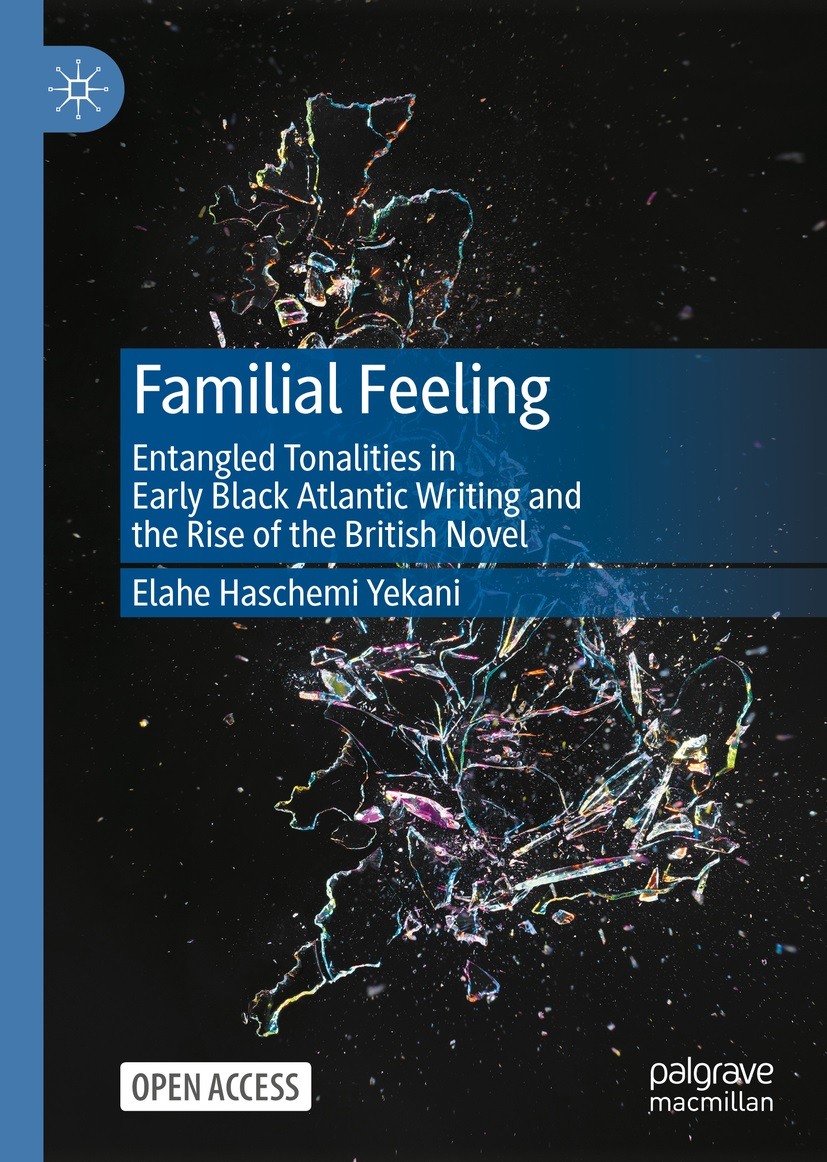2011 begann ich mit der Arbeit an meinem nun jüngst erschienenen Buch Familial Feeling: Entangled Tonalities in Early Black Atlantic Writing and the Rise of the British Novel. Zu diesem Zeitpunkt lagen die zahlreichen Ausstellungen und Events, die 2007 das zweihundertjährige Jubiläum der Abschaffung des Sklavenhandels in Großbritannien flankierten, erst wenige Jahre zurück. Es gab in der britischen Öffentlichkeit kontrovers geführte Auseinandersetzungen, wie dieses Erbe der Entmenschlichung von Personen als Güter angemessen zu erinnern sei. Zwischenzeitlich verlor diese Reflexion jedoch an gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und britische nationale Identität schien sich nur noch um die spaltenden und anhaltenden Brexit-Debatten zu drehen, die nicht zuletzt auch von einer, wie Paul Gilroy es nennt, „postkolonialen Melancholie“, also einer Nostalgie nach einer vermeintlich weißen nationalen Homogenität geprägt waren. Eine Auseinandersetzung mit der diversen britischen Gegenwartsgesellschaft wurde so zugunsten einer Romantisierung des Empires und internationalen Vormachtstellung vor dem Zweiten Weltkrieg verdrängt.
Doch 2020 wurde im Zuge der globalen Proteste gegen Rassismus infolge der Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus auch das Gedenken an die Versklavung von Schwarzen Menschen erneut machtvoll ins Gedächtnis gerufen. In Bristol wurde bekanntlich bei Black Lives Matter Protesten die Statue von Edward Colston gestürzt und in das Hafenbecken geworfen. Dies verdeutlicht, wie zentral kulturelle Artefakte sind in der Art und Weise, wie Vorstellungen nationaler Zugehörigkeit verhandelt werden und warum die Verehrung derjenigen, deren Reichtum auf der Entmenschlichung und Ausbeutung anderer beruht, im öffentlichen Raum nicht mehr unangefochten bleibt. An dieser Stelle sei das Gedicht „Hollow“ von Vanessa Kisuule (Bristol City Poet von 2018-2020) empfohlen, die den Denkmalsturz lyrisch reflektiert.

Für ein Verständnis der Debatte um eine angemessene Erinnerungskultur ist mir besonders wichtig festzuhalten, dass hier nicht einfach anachronistisch zeitgenössische Maßstäbe angelegt werden. Die Statue von Colston (der von 1636 bis 1721 lebte) wurde erst 1895 errichtet als die Versklavung von Menschen in britischen Territorien bereits lange verboten war. Wie mein Blick in die Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts zeigt, sind die öffentlichen Diskurse der Zeit durchaus bereits durch eine vielstimmige Kritik an Versklavung, an der auch Schwarze Autor*innen teilhatten, geprägt. Die Vorstellung, dass Schwarze Menschen erst im Zuge der sogenannten Windrush-Generation nach dem Zweiten Weltkrieg in Britannien fußfassten, übersieht somit erstens die zahlreichen globalen Verflechtungen, die bereits im 18. Jahrhundert zu verschiedensten (oftmals von Gewalt und Ausbeutung geprägten) Formen der Mobilität von Menschen und Gütern führten, und zweitens, dass es natürlich auch schon immer Widerstand gegen diese Form von Ausbeutung gab. Erinnerungskultur ist damit nicht einfach das Ergebnis einer neutralen Abbildung der Geschichte, sondern immer auch Produkt von Machtverhältnissen.
Verflochtene Erzählungen
Auch die englische Literaturgeschichte kann unter den Vorzeichen der Verflechtungsgeschichte anders betrachtet werden und genau diese Perspektive prägte mein Forschungsvorhaben. In dem Buch spreche ich von „entangled tonalities“, also verflochtenen Tonarten nationaler Zugehörigkeit. Mich interessierte dabei, wie insbesondere der Roman und zunehmend realistische Formen der narrativen Ausgestaltung von Identität das bürgerliche Selbstverständnis als ein „familial feeling“ prägten. Während wir uns in den postkolonialen Literaturwissenschaften häufig mit der retrospektiven Herausforderung des Kanons unter dem Schlagwort „the empire writes back“ beschäftigt haben, lassen sich bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts Texte von Autor*innen finden, die als Teil des frühen Black Atlantic Writing verstanden werden.
Konkret geht es in dem Buch also um eine ästhetische Neubewertung kanonischer Werke und den sogenannten Aufstieg des britischen Romans („rise of the novel“) durch eine Gegenüberstellung und Dialogisierung jener Texte mit den Selbstzeugnissen der frühen Black Atlantic Autor*innen. In vier Kapiteln widme ich mich unterschiedlichen Ästhetiken, die nationale Zugehörigkeit als eine Art britische Familiarität erzählen. Bei Daniel Defoe und Olaudah Equiano werden die Grundlagen für den realistischen Roman gelegt, wobei ich die Insularität von Daniel Defoes Robinson Crusoe von der Intersubjektivität in Olaudah Equianos Erzählung abgrenze. Laurence Sterne und Ignatius Sancho wiederum bestechen durch ihre abschweifende sentimentale Erzählhaltung, die das problematische, oft voyeuristische Interesse an Versklavung durch die sogenannten „men of feeling“ prägte. Jane Austen und Robert Wedderburn, deren Texte nach der Abolition des Sklavenhandels erschienen sind, verhandeln eine neue aufmüpfigere Innenschau von Frauen und People of Colour. Deren Ausgrenzungserfahrungen wurden jedoch in der Rezeption von Austens Mansfield Park häufig problematisch analogisiert, indem der Status von Frauen auf dem „marriage market“ mit Versklavung gleichgesetzt wurde.
Mit der zunehmenden kolonialen Expansion zur Mitte des 19. Jahrhunderts wiederum werden nationale Narrative stark durch Metaphern der vergeschlechtlichten und familiären Ordnung geprägt. So kann sich Mary Seacole, die auch als Schwarze Florence Nightingale tituliert wurde, als britische mütterliche Kriegsheldin inszenieren, während sich Charles Dickens in seinem Reisebericht als eine väterliche Persona geriert und nun den USA paternalistisch eine Rückständigkeit im Kampf gegen die Sklaverei attestiert. Zugleich werden so Vorstellungen einer britischen Überlegenheit und „civilising mission“ konsolidiert.
Das Anliegen des Buches ist damit nicht, die Schwarzen Autor*innen als außergewöhnliche revolutionäre Subjekte aufzuwerten, sondern mir war daran gelegen zu zeigen, wie sehr das Wechselverhältnis von Eigenem und Anderem seit jeher auch von denjenigen herausgefordert wird, die vermeintlich keine oder wenig Handlungsmacht haben. Dies bedeutet nicht, Machtgefüge zu ignorieren, sondern Literatur auch als den Ort zu verstehen, an dem Aushandlungen nationaler Zugehörigkeit ausgetragen wurden und werden. Ich schließe das Buch mit einer Reflexion darüber, wie wir durch eine Anerkennung negativer Gefühle einen angemesseneren Zugang zum Archiv der Versklavung finden können, statt einer andauernden Überhöhung der Vergangenheit anheimzufallen.
Elahe Haschemi Yekani ist Professorin für Englische und Amerikanische Literatur und Kultur mit einem Schwerpunkt in Postcolonial Studies am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Humboldt-Universität zu Berlin. Mehr zur Person hier: https://hu.berlin/haschemi-yekani. Ihr Buch „Familial Feeling: Entangled Tonalities in Early Black Atlantic Writing and the Rise of the British Novel“ ist 2021 bei Palgrave Macmillan erschienen. Es ist frei zugänglich als open access erhältlich: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58641-6