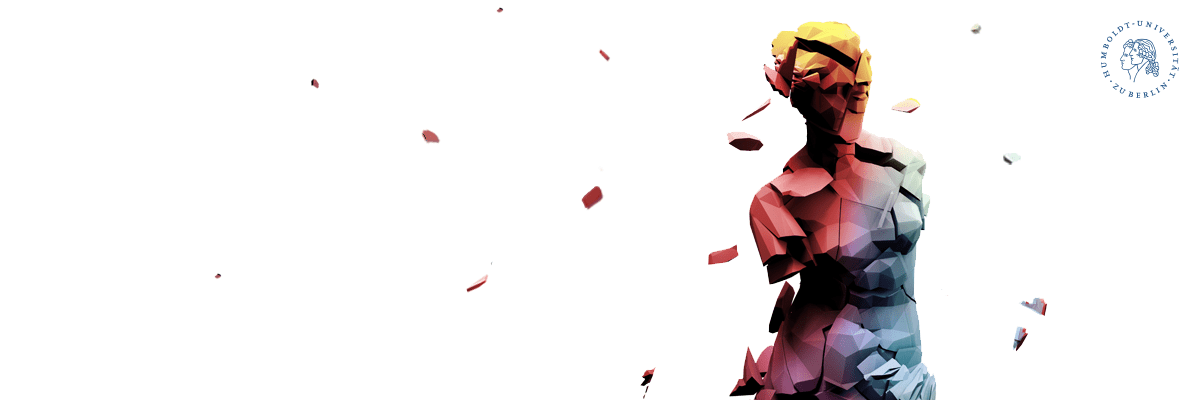Zwischen Bücherstapeln zu materialistischem Feminismus, europäischen Hexenverfolgungen, Kolonialismus und Schlangensymboliken kreuzen sich auf meinen Schreibtischen verschiedene Diskurse. Fragen, die momentan meine Forschung prägen, sind insbesondere, wie Körper dämonisiert werden, wie sich das Monströse politisch deuten lässt und wie alte Symbole in neue Kämpfe übersetzt werden können. Kapitalismuskritik, politischer Messianismus und utopisches Denken bilden den Hintergrund und zugleich den Fluchtpunkt meiner Interessen: Widerstand gegen Herrschaft und die Möglichkeit einer befreiten Welt.
Mein Schreibtisch im Büro
Mein neuster Schreibtisch, der in einem Büro des Instituts für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin steht, ist vor allem der Lehre und Institutsangelegenheiten gewidmet. Hier stapeln sich neben zu korrigierenden Klausuren Bücher, die mit meinen Seminaren zusammenhängen. Diese befassten sich zunächst mit den europäischen Hexenverfolgungen und Diskussionen um feministische Möglichkeiten der Wiederaneignung der Figur der Hexe. Daraus entwickelten sich Folgeseminare, die Fragen nach genealogischen Mustern der Dämonisierung von Weiblichkeit, nach religiösen und mythologischen Dämon:innen sowie nach historischen und diskursiven Figurationen von Monstrosität aufgriffen.
Immer wieder überschnitten sich diese Themen mit meinem kulturwissenschaftlichen Gender Studies-Einführungsseminar. Nicht nur stammen viele ikonische und richtungsweisende Texte über Monster Theory aus den Trans Studies. Die vergeschlechtlichte Verteufelung der biblischen Eva wie auch weiblicher Dämoninnen wie Lilith oder Lamia steht beispielsweise auch in unmittelbarer Nähe zur gegenwärtigen Transmisogynie, etwa in der Projektion exzessiver Sexualität, dem Motiv der Verführung und Täuschung, der Markierung hybrider Körperlichkeit und der Angst um Reproduktion. Gerade in der Zusammenschau von kulturhistorischen Quellen zur Dämonisierung von Gender und zeitgenössischen theoretisch-politischen Texten aus den Trans und Gender Studies eröffnet sich ein produktives Spannungsfeld, das sowohl historische Kontinuitäten als auch aktuelle Kämpfe um körperliche Selbstbestimmung und die emanzipatorische Transformation der sozioökonomischen Verhältnisse sichtbar macht. Eine solche Verflechtung von politischer Geschichte mit theoretischen Perspektiven und kulturhistorischen Diskursen gehört zu meinem spezifischen Grundverständnis der Berliner Kulturwissenschaft.
Neben der Seminarvorbereitung ist mein Schreibtisch im Büro auch Ort der Kommunikation mit den Studierenden, mit denen ich im Seminar durch diese kulturwissenschaftliche Linse auf Diskurse, ihre Ränder und ihre teils unwahrscheinlichen Nachbarschaften blicke. Gerade in Sprechstunden freue ich mich immer wieder mitzubekommen, wie Themen, die mich beschäftigen, auch für meine Studierenden Ausgangspunkte eigenständigen wissenschaftlichen Arbeitens sind. Dabei kommen auch immer wieder Fragen auf, wie denn ein kulturwissenschaftliches Argument in einem Text aussehen könne, oder wie die wissenschaftliche Arbeit am besten zu meistern sei. Fragen, die mich in ähnlicher Form selbst häufig herumtreiben.
Mein Schreibtisch zuhause
Sobald ich mit einem Buch nicht nur im Rahmen der Lehre arbeite, sondern es auch für meine anderen Projekte spannend wird, nehme ich es mit nach Hause; so beispielsweise Mithu Sanyals Buch über die Vulva, in welchem sich spannende Spuren für mein Dissertationsprojekt zur Schlange finden. Auf meinem Schreibtisch zuhause reihen sich dementsprechend zahlreiche und vielfältige Bücher – teils zum noch nicht endgültig umrissenen Thema meines Dissertationsprojektes, teils für eine derzeit entstehende Herausgabe zum Thema Männlichkeiten, teils für verschiedene Schreibprojekte.
Neben viel erzählender Literatur, die ich entweder noch nicht gelesen habe, oder über die ich gerne einmal akademisch schreiben würde, sticht eine Reihe Bücher hinaus, die sich aus religionsgeschichtlichen und theologischen, mythologischen und (besonders schräg) esoterischen Perspektiven mit einem besonderen Tier, beziehungsweise Tiersymbol, beschäftigen: die Schlange. Schon seit meiner Kindheit begleitet mich dieses Tier. Als sie mir dann auch beim wissenschaftlichen Arbeiten immer häufiger begegnete, begann ich mein Dissertationsvorhaben über dieses mal gefürchtete, mal verehrte Tier zu planen. Die Schlange steht an den Schnittstellen von Mythos und Politik, Feminismus und Postkolonialismus, Natur und Kultur, Herrschaft und Widerstand. Sie ist von Ausrottungsgeschichten geprägt, könnte eine Ehrenrettung vertragen und ließe sich als subversives Symbol deuten und aneignen, was ihre politische Geschichte als Emblem kolonialer Herrschaft nur umso widersprüchlicher macht. Mein erster Aufsatz in diesem Forschungskontext ist im Entstehen, der die christliche Dämonisierung der Schlange im siedlungskolonialen Entstehungskontext der späteren USA verfolgt und die Schlange nicht nur symbolisch behandelt, sondern auch die Kolonialgeschichte der realen Tiere berücksichtigt. Und es gäbe weitere, unzählbare Fährten und Richtungen – wie ich diese eingrenzen und trotzdem meines Anspruches einer vielumfassenden Doktorarbeit gerecht werden kann, bleibt zu klären. Doch an meinem Schlafzimmer-Schreibtisch widme ich mich diesen Fragen eigentlich nie. Hier deponiere ich vor allem Bücher und Texte, bis sie an der Reihe sind, mit in eine meiner Lieblingsbibliotheken genommen zu werden.
Mein Schreibtisch überall
Eine bewährte Praxis, die mich auch nach Abschluss meines Studiums weiter begleitet, obwohl ich inzwischen ein Büro zur Verfügung habe, welches ich mir mit niemandem teile, ist das häufige und freudige Arbeiten in Lesesälen von Bibliotheken in Mitte, Tiergarten oder Dahlem. Etwas an der luftigen Atmosphäre dieser gemeinschaftlich genutzten Räume ermöglicht mir besonders konzentriertes Arbeiten. Vor allem für die Textarbeit suche ich mir hier einen Schreibtisch – sei es, um besonders knifflige Texte zu lesen, an Proposals und Texten zu schreiben, oder auch um Texte zu redigieren, die hier im Genderblog erscheinen, dessen Redaktionsteam ich angehöre. Es sind also viele verschiedene Schreibtische, an denen ich arbeite. Gleichzeitig arbeite ich auch immer an demselben Cloud-Schreibtisch, der mich ins Büro, nach zuhause, in die Bibliothek oder auch auf das Sofa begleitet – von überall habe ich Zugriff auf diesen einen Ort, an dem meine Arbeit zusammenkommt. Dort herrscht übrigens auch die strengste Ordnung, auch wenn er – wie jeder meiner Schreibtische – Unzähliges beherbergt. Dass keiner meiner Schreibtische jemals leer ist, empfinde ich als Geschenk. Auf ihnen finden sich Gedanken, die ich mir für die Zukunft notiert habe, Materialien aus prägenden Seminaren meines Studiums, Stapel von Büchern und zahllose PDF-Dateien. Sie erinnern mich daran, dass wissenschaftliches Arbeiten nie bei null beginnt, sondern immer schon von etwas getragen wird, das es ermöglicht, weiterzumachen. Auch, wenn dieses ‚Weitermachen‘ nicht selbstverständlich ist. Es hängt an ökonomischer Absicherung, an Zukunftsperspektiven, am Zeitmanagement und an den Bedingungen wissenschaftlicher Freiheit. Und doch kommen sie immer wieder, die Ideen – und die Verpflichtungen –, die mich an den Schreibtisch ziehen.
Xenia Müller ist seit Oktober 2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr- und Forschungsbereich Historische Anthropologie und Geschlechterforschung von Prof. Dr. Claudia Bruns am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben der Lehre und ihrem Dissertationsprojekt zur Kulturgeschichte der Schlange arbeitet sie zurzeit an der Herausgabe eines Sammelbandes zum Thema Männlichkeiten zwischen Verletzlichkeit und Gewalt.