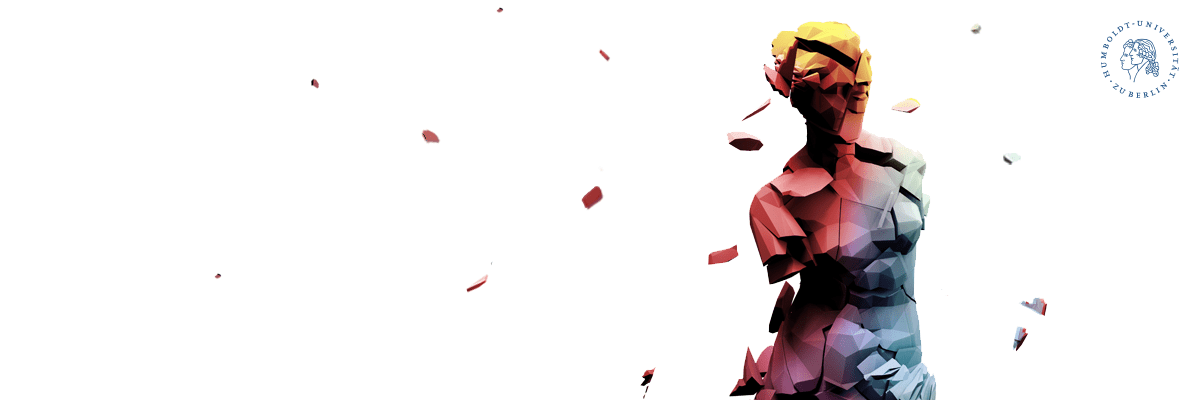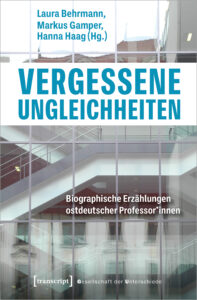Die im Oktober 2024 von Laura Behrmann (Universität Wuppertal) und Hanna Haag, (Gender- und Frauenforschungszentrum der Hessischen Hochschulen gFFZ), initiierte zweitägige Konferenz in Frankfurt am Main machte ernst mit dem Versuch, den Osten nicht – wie schon so oft – als Looser beziehungsweise Opfer westdeutscher Politik und Projektionen erzählen zu wollen. Auch wenn die konsistente Gegenerzählung noch nicht geschrieben ist, zeigte das Potpourri empirischer Beispiele ostdeutsche Kreativität, Kompetenz und Gestaltungskraft, ein Bild vom Osten, das der Beschreibung vom „Dunkel-Deutschland“ entgegensteht.
Präsentiert wurden Einblicke in sehr erfolgreiche Aktivitäten sozialer (Frauen-)Gruppen, in kommunale und regionale Projekte, beispielsweise zum – aus leidvollen Erfahrungen in der DDR hervorgegangen – regionalen Umweltschutz wie auch zur Community-basierten Antirassismus-Arbeit. Diskutiert wurden darüber hinaus theoretische Fragen der besonderen Rolle von Wissenschaft, Vision und von Literatur im Prozess des Strukturwandels Ost.
Mit diesem breiten Mosaik von Themen und Analysen wurde versucht herauszufinden, was den Osten in einem progressiven transitorischen Sinne „anders“ macht. Worin besteht seine besondere, möglicherweise auch für den anstehenden gesamtdeutschen Strukturwandel wichtige Transformationskompetenz? Woher rührt sie und inwiefern ist sie eine Chance für auf Selbstermächtigung basierende ostdeutsche „Wiederaneignung“?
Ein provokanter Aufschlag
Den Aufschlag hat Stephan Lessenich, Goethe Universität, Frankfurt am Main, übernommen: „How the East was won. Der Osten als Projektionsfläche und Erfahrungskategorie“ lautete der Titel seines Referats, das sich in zwei Teile gliederte. Zunächst sind die strukturellen und mentalen Machtasymmetrien der „Wiedervereinigung“ begrifflich knapp und sehr zugespitzt auf den Punkt gebracht worden: Institutionelle Kolonialisierung führte zu sozialstruktureller Überschichtung in Ostdeutschland; die marktlogische Deindustrialisierung sei durch subventionierte Restauration begleitet worden; die symbolische Immobilisierung der Ostdeutschen wurde von sozialräumlicher Mobilisierung konterkariert; Zudem sei Ostdeutschland exotisiert worden, wobei seine Vergangenheit dennoch nicht vollständig vergehen sollte. Die deutsche Einheit könne so gesehen als nationales Spaltungsprogramm gelesen werden.
Im zweiten Teil seines Vortrags wandte sich Lessenich der „Wiederaneignung“ des Ostens durch Ostdeutsche zu. Dabei komme den in Ostdeutschland intergenerational aufgeschichteten, klassenübergreifenden Kollektiverfahrungen der Subalternität Handlungsrelevanz und Bedeutung zu. Es gäbe Anzeichen einer selektiven Emanzipation von kolonialen Zumutungen, durch die der Osten nicht nur literarisch, sondern alltagspolitisch neu erzählt werden könne.
Das Programm
Die Tagung strukturierte sich in vier Panels: 1. Geschlecht als biographische Transformationskompetenz, 2. Strukturwandel Ost. Chancen und Herausforderungen, 3. Netzwerke und Gemeinschaften als Räume des Zusammenhalts, 4. Gegenerzählungen finden. Den Osten anders ins Gedächtnis rufen. Darüber hinaus fand eine Podiumsdiskussion zum Thema „Den Osten neu erzählen – Über die Bedeutung von Literatur für das kollektive Gedächtnis Ost“ statt. Diskutant*innen waren die Autor*innen Stephan Pabst, Johannes Nichelmann, Paula Fürstenberg, die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Literarische Gesellschaften, Pauline Stolte, und der Moderator Tim-Tih Kost.
Geschlecht als biographische Kompetenz?
Weder die Tagung insgesamt noch der hier im Mittelpunkt stehende Themenblock haben sich tiefergehend mit der Frage beschäftigt, was in einem analytischen Sinne unter Kompetenz zu verstehen ist und wie „biographische Kompetenz“ oder „Transformationskompetenz“ zu definieren und zu messen wäre. Schaut man sich verschiedene Definitionsangebote an, so werden in der Regel vier oder fünf Fähigkeiten zur Kompetenzbeschreibung gebündelt: Kreativität, Resilienz, Lernbereitschaft, Zuversicht und Selbstorganisation. Alternativ wird auf Schlüsselkompetenzen wie Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeiten oder Anpassungs-, Team-sowie Umsetzungsfähigkeiten verwiesen.
Ob und inwiefern Kompetenzen in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich entwickelt sind und inwiefern sie auch mit dem Geschlecht verschieden sozialisiert wurden, wie das die Überschrift des Panels nahelegt, ist bisher nicht eindeutig belegt. Es darf hingegen mit einiger Sicherheit unterstellt werden, dass die gesellschaftlichen und sozial-politischen Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland und die zum Teil gegensätzlichen Herausforderungen, die in den vergangenen 35 Jahren deutsche Einheit zu bewältigen waren, auch mit unterschiedlichen Prägungen und erfahrungsbasierten Kompetenzen einhergehen. Empirisch unterfüttert wurde die Argumentation beispielsweise durch ein Referat von Julia Gabler (Hochschule Zittau) das die auf Engagement, Enthusiasmus und Netzwerkarbeit basierenden Leistungen von Frauen im Strukturwandel Lausitz aufzeigte. Hanna Haag und Lotte Rose (gFFZ) analysierten den Aspekt der inhärenten Vergeschlechtlichung in den biographischen Erzählungen ostdeutscher Professor*innen, die im 2024 erschienenen Band „Vergessene Ungleichheiten“ von Behrmann, Gamper und Haag herausgegeben worden sind.
Ob aber Ostdeutsche, insbesondere Frauen, tatsächlich eine besonders erfolgreiche Transformationskompetenz entwickelt haben, bleibt eine weitgehend offene Forschungsfrage.
Alte Fragen und neue Herausforderungen am Beispiel des Geschlechterverhältnisses
Das in den Themenblock einführende Referat von Hildegard Maria Nickel problematisierte das Spannungsfeld von „Gleichstellungsvorsprung“ im Osten einerseits und alten, auch in der DDR nicht hinreichend gelösten sozialen Schieflagen im Geschlechterverhältnis andererseits. In gleichstellungspolitischer Hinsicht ist in Ostdeutschland immer noch von einem „Vorsprung“ gegenüber Westdeutschland zu reden. Wegen der hohen vollzeitlichen Erwerbsbeteiligung von Ostfrauen und eines vergleichsweise geringeren Pay Gaps kann das Geschlechterverhältnis auch als flacher hierarchisiert beschrieben werden. Ost-Frauen sind nicht nur häufiger Alleinerziehende, sondern häufiger auch „Familienernährerinnen“ in Haushaltskonstellationen, wo der Partner (noch) weniger verdient, als die Partnerin. Allerdings ist die vornehmlich an der Erwerbsbeteiligung gemessene Gleichstellung nicht kurzschlüssig als erfolgreich realisierte gesellschaftliche Emanzipation zu interpretieren. Wenn Ost-Frauen als Vorreiterinnen eines einseitig ökonomistisch verstandenen „adult worker models“ heute gefeiert werden, droht ihre biographische Kompetenz auf problematische Weise vereinnahmt zu werden. Sie scheint dem Festhalten an einer neoliberalen Wirtschaftspolitik dienlich zu sein, die gegenüber den komplexen menschlichen Lebensbedürfnissen blind ist. Der Schutz des Sozialen vor den Übergriffen kapitalistischer Ökonomie und neoliberaler Politik ist im Transformationsprozess sträflich vernachlässigt worden. Dass Ostdeutschland mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland auch zum Experimentierfeld des Westens und zum „Labor des Neoliberalismus“ (Mau) gemacht worden ist, muss sich nicht fortsetzen. Die gesellschaftliche Transformation ist eine Herausforderung, die in West- und Ostdeutschland ansteht. Sie kann nur erfolgreich gelingen, wenn sie als korrelierender, miteinander verbundener sozialer Prozess gestaltet wird.
Hildegard Maria Nickel ist Professorin a. D. für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Mitgründerin und von 1993 bis 2002 wissenschaftliche Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Frauenforschung (ZiF). Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen empirisch-soziologische Projekte zum Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und zu gesellschaftlichen und betrieblichen Transformationsprozessen.