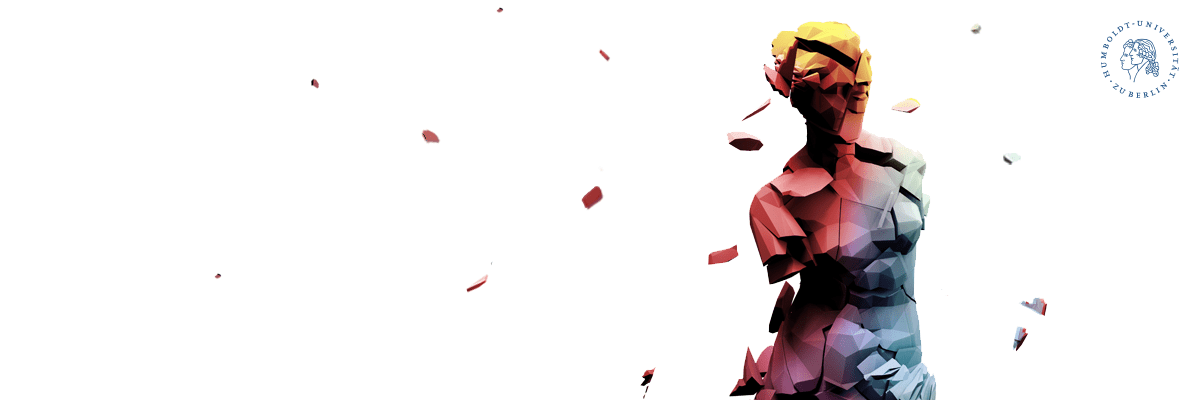Im Sommer 2025 konnten viele Christopher-Street-Day-Paraden nur unter massivem Polizeischutz stattfinden. Bereits im Vorfeld wurden sie von rechten, gewaltbereiten Gruppierungen bedroht. Damit wird gezielt versucht, die Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community zu unterdrücken. Laut Verfassungsschutz besteht sogar Gefahr für Leib und Leben. Zugleich nimmt die Pluralität an Lebensformen zu: Ob in Schulen, in Kitas oder auf Spielplätzen – Kinder mit zum Bespiel zwei Müttern sind in vielen Städten mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Auch rechtlich erfahren LGBTQ+-Personen zunehmend Gleichberechtigung, etwa durch die „Ehe für alle“ (2017) oder durch das 2024 in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), das das teils verfassungswidrige Transsexuellengesetz (TSG) ablöste. Sichtbarkeit ist dabei ein zweischneidiges Schwert: Sie macht lebbar, was zuvor unsichtbar war, mobilisiert aber zugleich jene, die Selbstbestimmung und Vielfalt bekämpfen.
Empirische Studie zu „Regenbogenfamilien“
Rechtliche Anerkennung ist ein wichtiger Schritt, doch wie spiegelt sich diese konkret im Alltag von LGBTQ+-Familien wider? Wie ist es für sie, eine Familie zu gründen? Welche Herausfor-derungen begegnen ihnen? Unsere Interviewstudie „Ambivalente Anerkennung. Doing repro-duction und doing family jenseits der heterosexuellen Normalfamilie“ liefert dazu spannende Einblicke. Von 2018 bis 2021 haben wir in einem von der DFG finanzierten Projekt (Projektnummer 367423336) 19 ausführliche Paar- und Familieninterviews sowie einige Einzelinterviews mit Menschen in 13 unterschiedlichen Familienkonstellationen jenseits der Heteronorm durchgeführt. Dazu zählten etwa Zweimütter-, Zweiväter-, Drei- und Vierelternfamilien, Co-Parenting-Konstellationen, Pflegeeltern und Familien mit trans* und polyamoren Eltern. Wir fragten: Wie werden Kinderwünsche in LGBTQ+-Familien realisiert (doing reproduction)? Welche Ungleichheiten und (rechtlichen) Hürden zeigen sich für die Familien dabei in ihrem gelebten Alltag? Wie gehen sie tagtäglich mit diesen Hürden und Ungleichheiten um (doing family und doing normality)?
Lange und steinige Wege in Elternschaft
LGBTQ+-Personen wurde lange abgesprochen, überhaupt Familien gründen zu können. Dies verdeutlicht uns Carolin Callas, die mit ihrer Partnerin ein Kind hat: „Und wenn man als geouteter Jugendlicher offen lebt, dann sagt das keiner zu einem: ‚Wenn du mal verheiratet bist, wenn du mal Kinder hast‘ – das passiert nicht. Und da entwickelt man sich automatisch hin“. Wir zeichnen daher die oft langen und steinigen Wege von LGBTQ+-Personen in die Elternschaft nach sowie die gesellschaftlichen Hürden, die sie bei ihrer Elternwerdung (doing reproduction) überwinden müssen. Erst wenn sie sich selbst als Eltern vorstellen können, können sie in einem zweiten Schritt darüber nachdenken und aushandeln, wie sie eine Familie werden wollen, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen und welche sie nutzen wollen. Im dritten Schritt folgt dann die konkrete Umsetzung bzw. der Weg in die Elternschaft. Hierbei zeigen sich große Unterschiede zwischen verschiedenen Familienkonstellationen. Wer wie Eltern werden kann, will, soll und darf, ist je nach Zusammensetzung der werdenden Eltern rechtlich, medizinisch, biologisch und persönlich unterschiedlich und äußerst komplex.
Rechtliche Ungleichheiten und Diskriminierungen
Weiter arbeiten wir heraus, mit welchen rechtlichen Ungleichheiten und Diskriminierungen LGBTQ+-Familien nach wie vor zu kämpfen haben und wie sich die fortbestehenden rechtlichen Ungleichheiten in die Praktiken von LGBTQ+-Familien einschreiben. So erfahren Zweimütterpaare die Notwendigkeit einer Stiefkindadoption trotz Ehe als Herabsetzung der Elternschaft der nicht-leiblichen Mutter. In Mehrelternfamilien fehlen den sozialen Eltern nahezu jegliche Rechte, was zu weitreichenden Unsicherheiten führt. Und das TSG vermittelte Familien mit trans* Eltern, dass ihre Elternschaft (rechtlich) nicht vorgesehen ist, was sie als Abwertung erfahren. Henrik Herwald erzählt, dass er sich vor seiner Elternwerdung gezwungen fühlte, sich zu entscheiden: Entweder Familie oder Transition. „Dann habe ich für mich überlegt: Was ist mir wichtiger? Also die Entscheidung zum Kind, zur Heirat war letztendlich für mich nur unter dem Umstand möglich, dass das andere eben nicht ging parallel.“
Normalisierungshandeln als Antwort auf Diskriminierung
Auch im Alltag sind LGBTQ+-Familien von rechtlichen, institutionellen und intersubjektiven Ungleichheiten betroffen. Was bedeutet dies für sie und wie gehen sie damit um? Unsere Gespräche zeigen, dass sie sich häufig vor der Aufgabe sehen, die „Normalität“ ihrer Familie zu behaupten. So präsentieren einige Befragte ihre Familien geradezu als „Musterfamilien“, wie etwa auch Gustav Gernheim: „Wir sind ne Familie, wir haben alle irgendwie Arbeit. Wir wohnen zusammen. Wir ziehen unsere Kinder zusammen auf. Wir sind vollbeschäftigt“. Wir fassen dieses Normalisierungshandeln (doing normality) nicht als unpolitische Anpassung an heterosexuelle Normen, sondern als existenziell notwendige Antwort auf erlebte Ungleichheiten und Diskriminierung. Dabei haben wir unterschiedliche Strategien herausgearbeitet, wie die Familien Normalität herstellen (müssen). Eine Befragte schildert uns etwa, wie sie ihre neuen Nachbar:innen nach ihrem Einzug mit selbstgebackenem Kuchen überraschten. Sie zogen von Tür zu Tür, damit sich niemand, so Carolin Callas „das Maul zerreißen muss“. Als lesbisches Paar agieren sie präventiv, da sie fürchten, dass andere Menschen abfällig über sie zu sprechen, weil sie nicht heterosexuell leben. Das Beispiel zeigt, dass das doing normality für die Familien aufwendig und anstrengend ist. Dieser Aufwand muss als Teil der angestrebten Normalisierung in der Regel unsichtbar gemacht werden. Weiter ist Normalisierung die Grundvoraussetzung dafür, ein unbeschädigtes Leben (Ahmed 2010) führen zu können, als Schutz gegen Angriffe von außen. Durch das Normalisierungshandeln der LGBTQ+-Familien können zudem neue Selbstverständlichkeiten an Bedeutung gewinnen und vielleicht zum new normal werden.
Anerkennung/sdefizite und Kämpfe um Anerkennung
Wie zeigt sich Anerkennung innerhalb der Familien? Wie werden sie gesellschaftlich anerkannt? Wir arbeiten im Anschluss an Judith Butler (u.a. 2002, 2010) und Axel Honneth (u.a. 1992, 2003) heraus, wie die LGBTQ+-Familien in Nahbeziehungen, im Recht und in der Sphäre sozialer Wertschätzung von Anerkennungsdefiziten und Diskriminierung betroffen sein können. Anschließend systematisieren wir die vielfältigen Kämpfe um Anerkennung, die die Familien angesichts der erfahrenen Anerkennungsdefizite führen.
Als mühsame und als existenziell notwendige Arbeit ist Normalisierung auch – neben anderen –eine Form des Kampfes um Anerkennung. Zudem mangelt es auch in LGBTQ+-Familien an umfassender Anerkennung für vergeschlechtlichte Reproduktionsarbeit und es finden sich altbekannte Geschlechterungleichheiten: beim Austragen und Gebären, bei der alltäglichen Sorgearbeit, dem Mental Load und anderem mehr.
Nicht zuletzt arbeiten wir die gesellschaftliche Nichtanerkennung queerer Reproduktionsarbeit angesichts der Hürden und des Mehraufwandes heraus, den sie im Familienalltag leisten und zugleich verstecken müssen. Loretta Laumann beschreibt den enormen Aufwand, den sie als Mehrelternfamilie leisten, um Familie zu sein und um als Familie wahrgenommen zu werden: „Und die Leistungen, die wir alle vier erbringen, sind mega, mega krass, ja? Und das auch oft mit vielleicht mit der Gesundheit, mit der Karriere, mit weiß ich nicht was bezahlen.“ Sie bringt damit auf den Punkt, was wir in unserem Fazit als doppelt abgewertete und unsichtbare Mehrarbeit der queeren Familien fassen.
Fazit: Bestehende Ungleichheiten und Normausweitung durch Normanpassung …
Zusammenfassend lässt sich festhalten: sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sind und bleiben zentrale Determinanten sozialer Ungleichheit. Somit bestimmen sie weiterhin wesentlich über Handlungsmöglichkeiten und Lebenschancen mit.
Gleichzeitig werden LGBTQ+-Familien zunehmend normal, das heißt: weniger begründungsbedürftig. Bisweilen wird diesbezüglich von manchen kritisiert, dass die Familien normative Familienideale einfach reproduzieren (Affirmation). Wir argumentieren hingegen, dass die LGBTQ+-Familien durch ihr Familie-Sein die hegemoniale Ordnung (im besten Fall) auch verändern (Transformation). Auch durch Normalisierung können neue Selbstverständlichkeiten an Bedeutung gewinnen. Die von uns befragten Familien greifen zudem auf (heterosexuelle) Familiennormen zurück, aber sie passen sich ihnen nicht einfach unkritisch an. Vielmehr verändern oder erweitern sie rechtliche und gesellschaftliche Normalvorstellungen darüber, was Elternschaft und Familie ist und sein kann.
So what und was tun?
Trotz wachsender Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit existieren gerade im deutschsprachigen Raum noch viele Forschungslücken. Und bei allem Veränderungspotential und allen Gleichstellungsgewinnen: es besteht auch weiterhin erheblicher gesellschaftspolitischer und rechtlicher Handlungsbedarf – beidem mangelt es, leider, gegenwärtig weder an Aktualität noch an Relevanz.
Literatur
Ahmed, Sara (2010): The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press.
Butler, Judith (2002): Is Kinship Already Always Heterosexual? In: Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies 13 (1), 14–44. https://doi.org/10.1215/10407391-13-1-14.
Butler, Judith (2010): Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt a.M., New York: Campus.
Honneth, Axel (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Honneth, Axel (2003): Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser. In: Fraser, Nancy/Honneth, Axel (Hg.): Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 129–224.
Teschlade, Julia, Mona Motakef und Christine Wimbauer (2025): Auf dem Weg zur Normalität? LGBTQ+-Familien und ihr Kampf um Anerkennung. Weinheim: Campus. https://www.campus.de/e-books/wissenschaft/auf_dem_weg_zur_normalitaet-18841.html
Julia Teschlade ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrbereich Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse an der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Geschlechtersoziologie, Re-/Produktionsarbeit, Soziologie der Nahbeziehungen (Schwerpunkt: vielfältige Familien), sexuelle und reproduktive Rechte, Reproduktionstechnologien, soziale Ungleichheiten, qualitative Methoden der Sozialforschung. Sie hat u.a. zur Elternwerdung schwuler Paare durch Leihmutterschaft publiziert (u.a. Teschlade 2024a, 2024b, 2022)
Mona Motakef ist Professorin für Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der TU Dortmund, Erste Sprecherin der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und Mitherausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien. Arbeitsschwerpunkte: soziologische Geschlechterforschung, Soziologie Sozialer Ungleichheit (Prekarität, prekäre Lebenszusammenhänge), Paar- und Nahbeziehungen, Familie und Elternschaft (vielfältige Familien), Arbeit (Erwerbs- und Reproduktionsarbeit), Temporalität und Lebensphasen sowie Interpretativen Methoden der Sozialforschung.
Christine Wimbauer ist Professorin für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse an der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Geschlechterforschung, Erwerbs- und Sorgearbeit, Paar- und Nahbeziehungen, Liebe und Familien jenseits der Heteronorm, soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse, Sozial- und Familienpolitik, Anerkennungstheorie, qualitative Methoden. Sie ist u.a. Autorin von „Wenn Arbeit Liebe ersetzt“ (2012, Campus), „Das Paarinterview“ (2017, Springer VS, mit Mona Motakef), „Prekäre Arbeit, prekäre Liebe. Über Anerkennung und unsichere Lebensverhältnisse“ (2020, Campus, mit Mona Motakef) und von „Co-Parenting und die Zukunft der Liebe“ (2021, transcript).