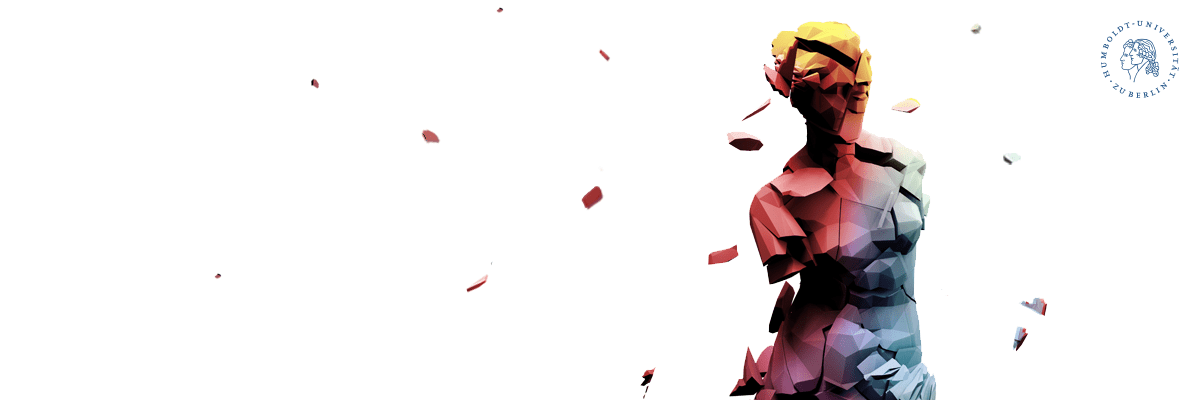Was passiert nach dem Gender Studies Studium? Lässt sich von den Inhalten und Werten aus dem Studium überhaupt etwas in der Arbeitswelt anwenden oder sind meine Schlussfolgerungen aus dem Studium vielleicht zu realitätsfern? Besonders in Zeiten des politischen Umbruchs, eines globalen Erstarkens konservativer und rechtspopulistischer Kräfte und der Kürzung von Finanzierungen auch für die Berliner Universitäten sehen sich viele Studierende mit Ängsten hinsichtlich der Realität nach dem Studium konfrontiert. Innerhalb des Mentoring-Programms des ZtG hatte ich die Chance meiner Mentorin Pauline Ahlhaus einige meiner Fragen zu stellen. Sie hat ebenfalls den Master Gender Studies an der HU studiert und arbeitet nun als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bundesstiftung Gleichstellung.
Geschlechtervielfalt und Intersektionalität: Herausforderungen in der Gleichstellungsarbeit
Das Masterstudium der Gender Studies ist thematisch sehr vielfältig, aber zwei inhaltliche Aspekte sind für mich besonders hervorzuheben: das Aufbrechen von binären Geschlechterkonzeptionen und die Betrachtung von Gender als intersektionale Kategorie.
Die Bundesstiftung Gleichstellung wurde 2021 mit dem Ziel der „Stärkung und Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland“ gegründet.
Hier wird offensichtlich eine binäre Vorstellung von Geschlecht angenommen. Für eine Gleichstellungsarbeit, die über diese binäre Logik hinausgeht, ergibt sich eine Herausforderung: Die Stiftung ist an ihren rechtlichen Auftrag gebunden, der sich auf Artikel 3 des Grundgesetzes stützt und bislang keine explizite Grundlage für eine Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Diversität bietet. Dennoch wurden 2024 zwei von der Stiftung herausgegebene Studien zum Thema Geschlechtervielfalt und nicht-binären Personen im Gleichstellungsrecht veröffentlicht.
Die Notwendigkeit einer intersektionalen Herangehensweise an Geschlecht ist innerhalb der Gender Studies ein allgemeiner Konsens. Auch in der Arbeit der Bundesstiftung Gleichstellung zeigt sich, wie wichtig ein solcher Ansatz ist. Beispielsweise erschien 2024 unter der Betreuung von Pauline Ahlhaus eine Studie zu Geschlechtergerechtigkeit im Aufenthaltsrecht. Allerdings, so erklärte mir meine Mentorin, scheitern intersektionale Analysen in der Realität oft an einer uneinheitlichen Definitionsgrundlage und einer schwerfälligen Operationalisierung. Durch kritische Forschung und Wissensvermittlung kann auf diese Leerstellen aufmerksam gemacht werden. Insgesamt ist die Bundesstiftung Gleichstellung -meines Erachtens- eine Institution, in der das vielfältige Wissen aus den Gender Studies wertschätzend angewandt werden kann. Jedoch erfordert diese Transferarbeit mitunter ein Aushalten diverser Wissensstände, Werte und Meinungen.
Transdisziplinarität als praxisnahe Schlüsselkompetenz?
Das Gender Studies Studium an der HU Berlin zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Wissen aus diversen Fachdisziplinen erworben wird und unter geschlechtsspezifischen Fragestellungen neue Perspektiven fächerübergreifend entwickelt werden können. Dies ist natürlich mit einigen Anstrengungen verbunden, lehrt uns Studierende jedoch auch Verbindungen zu ziehen und transdisziplinär zu arbeiten. Daraus entsteht eine Stärke, die für die spätere Berufswelt als eine wichtige Schlüsselkompetenz betrachtet werden kann. Es macht unser Wissen in den verschiedensten Bereichen anwendbar, erhöht die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten, und trägt dazu bei, Denkgewohnheiten zu hinterfragen.
Für die Arbeit in der Bundesstiftung Gleichstellung kann die transdisziplinäre Kompetenz aus dem Studium nur von Vorteil sein. Pauline Ahlhaus berichtete mir, dass sie sich für die Redaktion von Fachtexten und Studien in die verschiedensten Themenfelder einarbeiten muss, denn die Bundesstiftung Gleichstellung vergibt Forschungsaufträge in den Themenbereichen Arbeit, Zeit, Gewalt, Macht, Bildung & Wissen, Geld und Gesundheit, Nachhaltigkeit & Klima und Digitalisierung. Dabei sind natürlich auch diese Themenbereiche jeweils miteinander verschränkt und müssen zusammengedacht werden. Des Weiteren führt die Stiftung nun auch mit einer eigenen Abteilung den Gleichstellungs-Check ein: Die Bundesverwaltung soll darin geschult werden, wie jegliche Gesetzesinitiativen und -neuerungen auf ihre verschiedenen geschlechtsspezifischen Auswirkungen überprüft werden können. Auch hier wird also die Wichtigkeit einer transdisziplinären Arbeit deutlich.
Neben diesen Vorteilen sehe ich als Studierende die Transdisziplinarität des Studiums der Gender Studies und die damit verbundene Angewiesenheit auf Lehrimporte aus anderen Fachbereichen allerdings auch als ein Symptom der anhaltenden Unterausstattung der Gender Studies im deutschen Wissenschaftsbetrieb. Dies kann nicht nur eine wissenschaftliche Karriere erschweren, sondern auch Unsicherheiten im Berufsleben darüber erzeugen, wie viel Raum für dieses Thema eingenommen werden kann. Auch wenn die Existenz der Bundesstiftung Gleichstellung ein Gewinn für die Gleichstellungspolitik ist, spiegeln ihre vergleichsweise geringen finanziellen Mittel beispielsweise im Haushaltsplan 2024 auch die politische Relevanz wider, die dem Thema beigemessen wird. Abzuwarten bleibt außerdem, wie sich in der aktuellen Legislaturperiode die neue Zusammensetzung des Stiftungsrats auf die zukünftige Themensetzung auswirkt.
Arbeiten im Kapitalismus: Machtkritik und berufliche Perspektiven
Neben dem im Studium erworbenen Wissen beschäftigt mich auch die Frage, inwiefern sich meine persönlichen Werte in der Berufswelt wiederfinden. In verschiedenen Seminaren habe ich gelernt, das kapitalistische System kritisch zu hinterfragen und dessen Bedeutung für Machtverhältnisse zu analysieren. Für meinen Berufseinstieg wünsche ich mir daher eine*n Arbeitgeber*in, welche*r auch in der alltäglichen Arbeit machtkritische Ansätze verfolgt und auf die Bedürfnisse und die Gesundheit der Mitarbeitenden achtet. Aber ist diese Vorstellung vielleicht zu utopisch?
In den Gesprächen mit Pauline Ahlhaus zeigte sich, dass die Bundesstiftung Gleichstellung machtkritische Ansätze verfolgt. Beispielsweise wird die Doppelspitze des Direktoriums quotiert besetzt, innerhalb der Teams wird sich geduzt und es finden Teamklausuren sowie regelmäßige Coachings statt. Die Stiftung fördert das lebenslange Lernen ihrer Mitarbeiter*innen durch verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten und gibt somit Raum für kritische Auseinandersetzungen. Außerdem wird der Gesundheit der Mitarbeitenden eine hohe Priorität eingeräumt, zum Beispiel durch Belastungsanzeigen und niedrigschwellige Kommunikationsstrukturen. Nach meinem Eindruck ist die Stiftung als staatliche Institution dennoch nicht frei von Hierarchien und auch durch bürokratische Strukturen gekennzeichnet. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Bürokratie auch gleichzeitig Sicherheit für die Mitarbeiter*innen bieten und so möglicherweise dem neoliberalen System etwas entgegensetzen kann.
Insgesamt wurde mir deutlich, dass das Gender Studies Studium in gewisser Hinsicht eine Filterblase ist und der Übergang in die Arbeitswelt oft einen Spagat von Gelerntem und Anwendbarkeit mit sich bringt. Durch meine Mentoring-Beziehung habe ich jedoch erkannt, dass es Institutionen gibt, die Normierungen kritisch hinterfragen und gezielt Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit ergreifen. Ich konnte Hoffnung darin schöpfen, dass mein erlerntes Wissen in der Arbeitswelt durchaus gefragt ist und dass es auch hier Platz für kleine Utopien gibt.
Indra Schwartz hat einen Bachelor in Politik und Wirtschaft an der Universität Münster abgeschlossen und studiert seit dem Wintersemester 2023/2024 den Master Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Forschungsinteressen liegen hierbei vor allem in der Intersektionalität als Forschungspraxis, der sozialen Reproduktion und alternativen Care-Strukturen, sowie materialistischen und queertheoretischen Ansätzen.