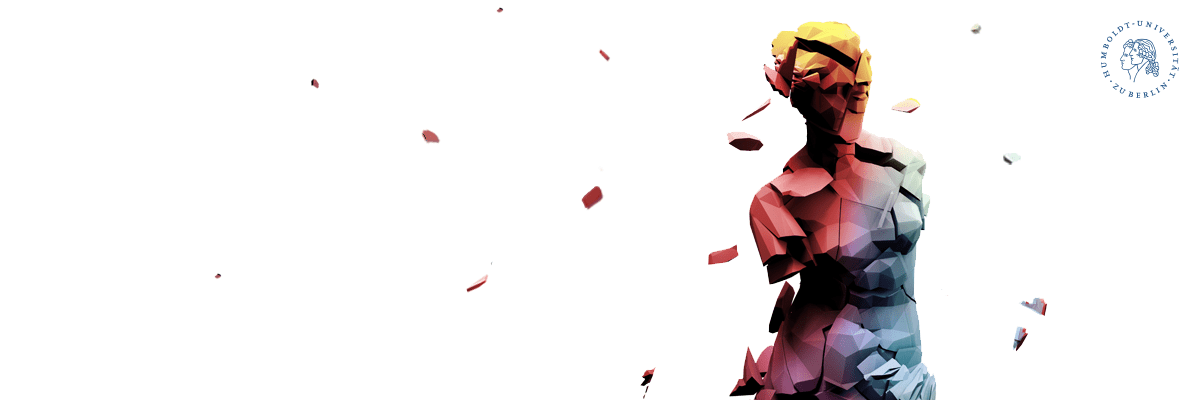Ob in den militärischen Rechenzentren Virginias oder in den High-Tech-Labors von Bell: Die Anfänge der Computernutzung waren von männlichen Denk- und Handlungslogiken dominiert. Aus der strukturellen Unsichtbarkeit von Frauen entstand ein Vakuum, das sich in ihrer Bildwerdung kompensierte: Computergenerierte Darstellungen weiblicher Aktmodelle markieren einen Schlüsselmoment der ‚Humanisierung als Sexualisierung‘ digitaler Bildproduktion. Sie überführten den (Geschlechts-)Körper in den digitalen Raum und verbanden tradierte Vorstellungen von Nahbarkeit mit technowissenschaftlicher Innovation. Den Impuls, dieses Thema im Rahmen meiner Masterarbeit zu vertiefen, gaben ein Kurs von Michael Homberg (Universität Potsdam) zu Computergeschichte(n) und der Besuch der Ausstellung „Electric Dreams“ in der Tate Modern. Der folgende Beitrag richtet den Blick auf die 1960er Jahre und untersucht, wie weibliche Nacktheit, Körperlichkeit und Sexualität mit der Entstehung und Legitimierung von Computerkunst verwoben sind. Welche Rolle spielte sie bei der Überführung des Computers aus militärischen und industriellen in kulturelle Kontexte – und beim Aufbrechen systemisch gewachsener Strukturen zwischen Kunst und Wissenschaft?
Pin-Up auf dem Militärradar: Wie sich der Male Gaze in die Computerkunst einprägte
1959, Militärbasis Fort Lee (Virginia): Ein junger Mann übt an einer bullaugigen Radarbildschirmanlage. Wo eigentlich sowjetische Bomber angezeigt werden sollen, erscheint nun die Silhouette eines Pin-Up-Girls. Ein anonymer IBM-Mitarbeiter hatte eine Figur aus dem Esquire-Magazin auf dem Bildschirm des 238 Millionen Dollar teuren Militärcomputers zum Leben erweckt. Herzstück des SAGE-Systems, jenes hochmodernen Luftabwehrsystems, das die USA im Kalten Krieg gegen eine befürchtete Nuklearoffensive der UdSSR einsetzten, war der AN/FSQ-7 – ein Computer von Gebäudegröße mit großformatigen Kathodenstrahlröhren, der über eine „Light Gun“ gesteuert wurde. Auf dessen Vektordisplay ließen sich nicht nur militärische Zielinformationen ablesen, sondern auch visuelle Inhalte er- und darstellen. Das Pin-Up selbst war als Abfolge algorithmisch generierter Linien programmiert und auf rund 97 Hollerith-Lochkarten codiert. Dokumentiert ist die Szene einzig durch eine Polaroidaufnahme des 21-jährigen Fliegers Lawrence A. Tipton: Eine leuchtende Umrandung eines sich räkelnden, vollbusigen Frauenkörpers, die direkt an die Pin-Up-Ikonografie der 1950er Jahre anschließt.
Pin-Ups hatten seit dem Zweiten Weltkrieg eine Doppelrolle als populäre Alltagsästhetik und militärische Propaganda – präsent auf Kalendern, in Spinden und nun erstmals auch auf einem Computerdisplay. Noch bevor Edmund Berkeley 1963 den Begriff „Computerkunst“ (in: Computers and Automation) prägte, war der „Male Gaze“ bereits in die frühe digitale Bildproduktion eingeprägt: In der Zweckentfremdung einer Militärmaschine mittels sexualisierender Bildsprache wurde eine zunächst exklusiv naturwissenschaftliche Technologie aus dem Bereich des Artifiziellen in den Artifizierenden verschoben.
In-your-face Pornography? In-your-face Art! Das erste Computer-Aktbild
1967 titelte The New York Times „Art and Science Proclaim Alliance“ – dies war ein programmatischer Ausruf, der den Aufstieg der sich damals erst konstituierenden Computerkunst markieren sollte. Bemerkenswerterweise geschah dies mit einem Akt-Bild: Vermutlich handelt es sich bei Computer Nude um das erste Werk, das in enger Zusammenarbeit des Künstler-Ingenieur-Duos Kenneth C. Knowlton und Leon D. Harmon an den Bell Telephone Laboratories entstand. Die Berufsbezeichnung der beiden wurde laut Knowlton in Ausstellungskatalogen per Münzwurf entschieden – ein spielerischer Akt, der der vorurteilsbeladenen Zuordnung von Kunst- oder Wissenschaftssystem zur Person entgegenwirken sollte. Unter dem Titel „Studies in Perception I“ schufen sie eine liegende Aktfigur als computergestützten Fotodruck, der umgehend in maßgebliche Computerkunstausstellungen der 1960er Jahre Eingang fand. Dass er zur Leitfigur der propagierten ‚Allianz von Kunst und Wissenschaft‘ wurde, lag wesentlich an der Wahl des weiblichen Akts als Kommunikationsmedium. Knowlton erinnert sich später in Mosaic Portraits (2004), dass die Bell Labs, erst nachdem das Aktbild 1967 in der ehrwürdigen Times Resonanz gefunden hatte, die Pionierleistung für sich reklamierten: „[…] our nude was not frivolous in-your-face pornography after all, but in-your-face Art.“ Obwohl in dieser Zeit mannigfache Computerstudien entstanden, wurde vor allem das Aktbild medial und diskursiv reproduziert. Hierzu erinnert sich der Computerkunst-Pionier Michael Noll:
“The attention on “The Nude” seems to have been [..] just because the image was a nude female […] a bunch of guys at Bell Labs looking for an excuse to photograph a nude woman. It seems that the nude bodies of women still generate publicity and much visual interest even today.”
Übersehene Protagonistinnen digitaler Avantgarde: Deborah Hay und Lillian F. Schwartz
Gegen diese Erzählung gegenderter Aufmerksamkeitsökonomie muss man die Geschichten zweier Frauen aus dem Umfeld der Bell Labs ins Licht verlustigter Beachtung rücken: Deborah Hay und Lillian F. Schwartz. Das Aktmodell der „Studies in Perceptions I“ – heute weitgehend unbenannt und unbekannt – ist die Choreographin Deborah Hay. Hay war bereits 1966 im Rahmen von „9 Evenings: Theatre and Engineering“ – einem intermedialen Performancekunstprojekt – in Kollaboration mit Bell-Labs-Ingenieuren tätig gewesen. Ihr fotografisches Aktportrait geriet als Schenkung an den Wissenschaftsberater von Präsident Nixon; es handelte sich also keineswegs um ein „No-Name-Pin-Up“: Die Anonymisierung zwecks Popularisierung fand erst durch Knowltons und Harmons Computergrafik statt. Und damit war sie keine Ausnahme; jene Frauen, die sich in vielfältigen Weisen (etwa als Modelle) in experimentellen digitalen Kunstpraxen engagierten – z.B. Henri Gouraud’s 3D-Gesichter (1971) – sind bis heute in ihrem Beitrag in der Computerkunst zu wenig gewürdigt und beforscht.
Eine wieder andere Perspektive ist die der Computerkunst-Pionierinnen Lillian Schwartz, die als erste Frau und unbezahlte „resident visitor“ in den interdisziplinären Kunst-Experimenten an den Bell Labs mitarbeitete. Unmittelbar nach der Veröffentlichung von „Studies in Perception I“ fertigte sie selbst eine Reihe computer-generierter Nudes an, die die anonyme Ehefrau eines Bell-Labs-Wissenschaftlers darstellten. Schwartz‘s Biografie ist durch Video- und Oral-History-Interviews gut dokumentiert, wobei sie auch auf die geschlechtsdisparaten Arbeits- und Anerkennungsstrukturen in der Szene eingeht. Ihre Haltung zu Computer Nudes spiegelt sich insbesondere in ihrem 1992 erschienenen Computer Artist’s Handbook. Darin berichtet Schwartz von ihrer Erstbegegnung mit „Studies in Perception I“, deren Machart sie als „Technological Pointillism“ bezeichnet. Zugleich parallelisiert sie die diskursiven Begleitumstände jener technisch-künstlerischen Zeitenwende mit Marcel Duchamps „Nude Descending a Staircase“, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Gründungsakt einer avantgardistischen Revolution (u.a. Chronofotografie) verkannt wurde. Duchamps Werk widmete Schwartz 1975 eine computergenerierte Hommage. Im Handbuch entfaltet sie eine kunsthistorische Genealogie von Aktdarstellungen – Dürer bis Picasso – und entwickelt daraus Anleitungen für das Studium von Aktmodellen im Computerzeitalter:
“Before turning to the computer, you should study and sketch nude models. […] Is the female body sublime, curvaceous, soft, indeterminate? […] You should try to understand why you react emotionally to figures. The tension you feel inwardly toward a nude female […] is a response that will affect your artwork.” (Schwartz, 1992, S. 67)
Damit ahnte sie eine Entwicklung voraus: Mit der Verbreitung des Computers vom Forschungslabor bis in den Privathaushalt verlagerte sich auch das Aktzeichnen zunehmend in den digitalen Raum. Modelle posierten nicht mehr nur für Maler:innen, sondern auch für Computergrafik-Studierenden. Zugleich kursierten auf Heimcomputern schon früh Nacktbilder – noch vor JPG oder GIMP –, wodurch die Grenze zwischen Aktkunst und Pornografie erstmals zu verschwimmen begann. Während Pionierinnen wie Rebecca Allan (Girl Lifts Skirt, 1974), Gretchen Bender (Pleasure is Back, 1982) oder Samia Halaby (Brass Woman 6, 1992) weibliche Ekstase, Körperlichkeit und Sexualität intersektional bearbeiteten, dominierten noch in den 1960er Jahren männliche Inszenierungen weiblicher Nacktheit; ein medientechnischer Shift, der alte Herrschaftsverhältnisse neu kodierte: Die Frau zwischen Begehren und Berechnung, das Computer Nude als kalkulierte Neu-Gier. Nackte Frauenkörper dienten der „Humanization of Technology“, schrieben sich in avantgardistische Bildtraditionen ein und fungierten – gestützt auf bestehende Bildkulturen von Pin-up und Playboy – als diskursiver Katalysator für die Öffnung zwischen Wissenschaft und Kunst.
Bibliographie
Edwards, B. (2013, January 24). The never-before-told story of the world’s first computer art (It’s a sexy dame). The Atlantic. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/01/the-never-before-told-story-of-the-worlds-first-computer-art-its-a-sexy-dame/267439/
Hicks, C. (n.d.). Art and the thinking machine: Coded: Art enters the computer age, 1952–1982. Art Papers. https://www.artpapers.org/art-and-the-thinking-machine-coded-art-enters-the-computer-age-1952-1982/
Knowlton, K. (2004–2005). Mosaic portraits. Retrieved from https://web.archive.org/web/20070926215810/http://lansdown.mdx.ac.uk/CAS/page/page59.pdf
Schwartz, L. (1992). Computer artist’s handbook: Concepts, techniques, and applications (pp. 9–13, 21, 58). London: Chapman & Hall. https://archive.org/details/computerartistsh0000schw/page/n5/mode/2up
Sdegno, A. (2017). For an archeology of the digital iconography. Proceedings, 1(9), 1093. https://doi.org/10.3390/proceedings1091093
Titelbild
Nutting Associates, Public domain, via Wikimedia Commons
Laura Brauer lebt und arbeitet in Berlin. Gegenwärtig studiert sie im Master Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität, ist am Lehrstuhl Religionswissenschaften sowie im DfG-Projekt „Applied Humanities“ tätig. Laura Brauer veröffentlicht regelmäßig in Studierendenzeitungen, theologischen Feuilletons, zuletzt bei SPIEGEL Geschichte und zeitzeichen.