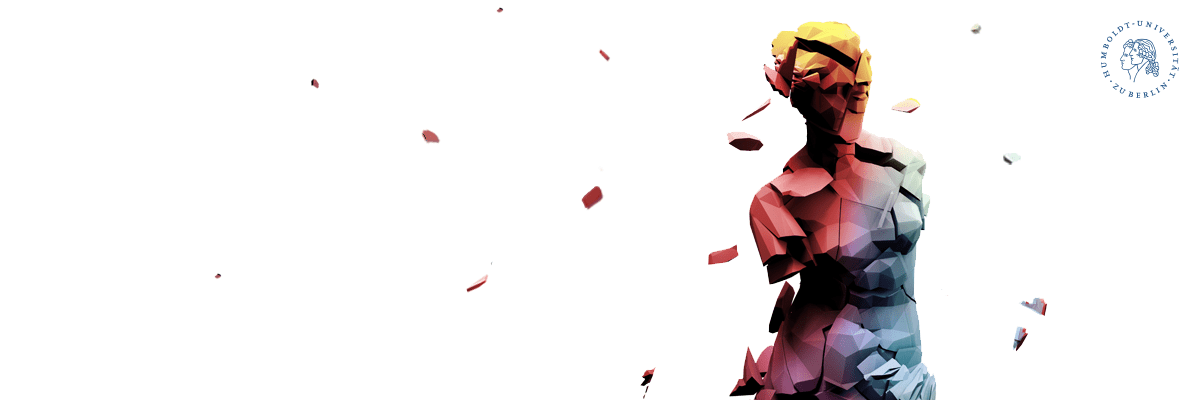„Wir schließen alle Gender Studies“, bewirbt eine deutsche Kanzlerkandidatin ihr Programm. In Österreich dürfte eine Partei den nächsten Kanzler stellen, die „Nein zur […] Queer Propaganda“ propagiert. Über „Anti-Genderismus“ spitzen sich Ausgrenzungs- und Gewaltdynamiken entlang historisch gewachsener Machtverhältnisse zu. Das betrifft auch Inhalte und Institutionen der Gender Studies. Aus privilegierter Perspektive erstarken hier – plötzlich – reaktionäre Kräfte. Wer umgekehrt an der intersektionalen Peripherie historisch gewachsener Machtverhältnisse lebt oder forscht, erlebt ein – erneutes – Zuspitzen von Kontinuitäten. Rufe nach „Mutual Aid“ oder „zärtlicher Bürgerlichkeit“ werden lauter. Gemeint sind Praxen, die historisch gewachsene Machtverhältnisse als Ursache von Verletzungsoffenheit begreifen, statt Betroffene zum Problem zu machen oder deren Handlungsmacht einzuschränken. Praxen, die Bedürfnisse der intersektional Verletzungsoffensten zu ihrem Ausgangspunkt machen, um Handlungsmacht für alle zu vergrößern. Praxen, die – im Wissen um gewaltsame Strukturen und die Notwendigkeit zu solidarischem Handeln – nicht aufgeben, nach einem „neuen Gemeinsamen“ suchen, das jenseits einer Verallgemeinerung von Partikulärperspektiven funktioniert.
Das Lehrformat „Re:Law/lehre“ bewegt sich in der Tradition der Feminist Judgements Bewegung. Es verfolgt den Anspruch, im Wissen um strukturelle Gewaltdimensionen des Rechts dessen emanzipatorische Kräfte zu erkunden. Studierenden des Master Gender Studies bietet es die Möglichkeit, in interdisziplinären Teams an konkreten Gerichtsentscheidungen zu arbeiten. Barrieren juristischer Eigenlogik sollen abgebaut und Wissensbestände interdisziplinär zugänglich werden. Zentrales Thema sind dabei die Fallstricke perspektivloser Objektivität. Sie stehen für ein Schlüsselproblem kritischer Rechtsverständnisse – und wir werden auch diskutieren, inwiefern dieses Problem im aktuellen Kontext von Debatten um zu (de-)politisierende Gender Studies und Wissenschaft breitere Relevanz entfalten könnte.
Von Feminist Judgments zum Projekt Re:Law
Recht ist auf vielfältige Weise mit historisch gewachsenen Machtverhältnissen verstrickt. Es ist Bedingung und Wirkung von Anthropozän, Kolonialismus oder Patriarchat. Für die Rechtswissenschaften bedeutet das ein „Provenienzproblem“. Gleichzeitig sperrt sich Recht mit seinen Versprechen von Würde, Freiheit und Gleichheit gegen die Reproduktion dieser Machtverhältnisse. Modernes Recht bietet die Möglichkeit für emanzipatorisches Einhaken und bleibt mit seiner Einbettung in Gewalt und Handlungsmacht doch spannungsvoll. Diese Ambivalenz des Einlassens auf Recht machte zu Beginn der 2000er Jahre auch einer Gruppe kanadischer Anwält*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen zu schaffen. Zusehends brachten damals Menschen Verletzungen gegen das noch junge Recht auf Gleichheit (vergleichbar mit Art. 3 Grundgesetz) vor Gerichte. Kleine Erfolge stellten sich ein und doch stellte sich heraus, der Supreme Court beschränkte sich auf ein formelles Gleichheitsverständnis. Materielle Gleichheitsansprüche, die Idee von Recht als Instrument zur Überwindung tatsächlicher, historisch gewachsener Ungleichheiten – etwa affirmative action und die Anerkennung mittelbarer oder intersektionaler Diskriminierung – blieb auf der Strecke. In dieser Situation entschied sich das Kollektiv aus Anwält*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen, der Welt zu zeigen, dass ein anderes Recht möglich war. Sie gaben ein Special Issue „ReWriting Equality“ heraus, in dem sie Entscheidungen des Supreme Court mit einem materiellen Gleichheitsverständnis umschrieben. Damit stießen sie eine zentrale Gründungserzählung der Feminist Judgments an.
Mit der Zeit haben vielfältige Initiativen die Idee der Feminist Judgments und die Methode des ReWritings aufgegriffen. In Brasilien entstand ein Projekt unter studentischer Beteiligung, ein indisches Projekt arbeitet postkoloniale Perspektiven heraus, ein internationales Anthropocene Judgments versucht sich an posthumanistischen Rechtsperspektiven – und das sind nur einige Beispiele. In Berlin ist aus der DFG-Forschungsgruppe Recht-Geschlecht-Kollektivität das interdisziplinäre Netzwerk Re:Law hervorgegangen. Im Fokus steht methodisch angeleitetes Überdenken von rechtsbezogenen Texten; ein Prozess des Einschreibens in das Recht, der zugleich eine Praxis der Rechtskritik verkörpert. Dazu haben wir in einem ersten Schritt Leitfragen für das Umschreiben im Genre „Gerichtsentscheidung“ entwickelt. Mit Re:Law/lehre konnte dann erstmals ein drittmittelfinanziertes Projekt ins Leben gerufen werden. Angebunden an den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien bietet Re:Law/lehre interdisziplinäre Seminare an, in denen Studierende im Master Gender Studies und aus den Rechtswissenschaften gemeinsam Gerichtsentscheidungen analysieren und neu schreiben. Eines dieser Seminare findet im Sommersemester 2025 statt – und wir laden ganz besonders Studierende des Master Gender Studies ein, dabei zu sein.
Call for Participation: Re:Law/lehre im Sommersemester 2025
Im Seminar gehen wir von der Einsicht aus, dass Recht niemals neutral ist. Es strukturiert gesellschaftliche Verhältnisse und reproduziert bestehende Ungleichheiten. Und es bietet Möglichkeiten zur Veränderung. Um diese zu nutzen, braucht es kritisches Hinterfragen historisch gewachsener Machtstrukturen, das Zentrieren marginalisierter Perspektiven und die Entwicklung neuer Denkräume. ReWriting ist damit weder rein juristische Übung noch beschränkt es sich auf das Außen des Rechts. Es geht darum, außerrechtliches Wissen aus Gender-, Queer oder Postcolonial Studies methodengeleitet mit juristischer Eigenlogik zu verknüpfen. Interdisziplinarität ist dabei ein Schlüsselelement. Im Peer-Learning erhalten Studierende der Rechtswissenschaften die Möglichkeit, jenseits der – im Studium alltäglichen – Rechtsdogmatik mit Recht zu arbeiten. So lässt sich das Zusammenspiel von Recht und Gesellschaft theorie- und methodengeleitet erfahren. Studierenden des Master Gender Studies bietet das Seminar Raum, sich juristische Eigenlogik anzueignen. Dazu zählen konkrete Techniken wie juristische Subsumtion ebenso wie Auseinandersetzung mit Barrieren, die im Recht als traditionell herrschaftlicher Disziplin angelegt sind.
Diese Barrieren drücken sich als perspektivlose Objektivität gegenüber einem gesellschaftlichen Außen aus. Sie erscheinen im Genre des Entscheidens als das letzte Wort, das „Recht haben“. Und sie können, wie wir in vergangenen Seminaren gelernt haben, im Seminarraum disziplinäre Wirkmächtigkeit entfalten. Für die wertvollen Rückmeldung und das Vertrauen von bisherigen Teilnehmenden bedanken wir uns an dieser Stelle. Im Projekt Re:Law/lehre geht es um die (Weiter)Entwicklung eines interdisziplinären Lehrformats und damit steht das Lernen auch für diejenigen, die das Seminar anbieten im Zentrum. Als unmittelbare Reaktion auf Feedback und Anregungen ist auch dieser Blogbeitrag entstanden: Wir möchten Studierende des Master Gender Studies explizit ermutigen, am Seminar teilzunehmen. In der Gestaltung des Seminars haben wir uns entschieden, vom bisherigen Block-Format abzugehen. Ein wöchentliches Format (Mittwoch, 16-18 Uhr) soll den Einstieg in rechtswissenschaftliche Perspektiven im kontinuierlichen Gespräch eröffnen und eine begleitete Eigenständigkeit im Umgang mit der ReWriting-Methode ermöglichen. Perspektivisch erweitern wir die Eingangsphase um rechtsanthropologische und literaturwissenschaftliche Inputs von externen Expert*innen. Ein Gastbeitrag zu Antiziganismus im Recht sichert Multiperspektivität auch während der gemeinsamen ReWriting-Arbeit ab. Im praktischen ReWriting werden wir uns mit Gerichtsentscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene auseinandersetzen und dabei Rechtsbereiche wie Migration, Antidiskriminierung oder Gewaltschutz besser kennenlernen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und zahlreiche Anmeldungen aus dem Master Gender Studies. Wer im Vorfeld Fragen hat, meldet sich gern unter sekretariat.baer@hu-berlin.de.
„Re:Law. Re:Writing von Recht als interdisziplinäre Praxis“, LV Leitung P. Sußner und Susanne Baer, SoSe 2025, jeweils Mittwoch 16-18 Uhr, Unter den Linden 9, 10099 Berlin, Juristische Fakultät. Raum wird noch bekannt gegeben. 8 LP, MAP als mündliche Prüfung / Hausarbeit. Modul 3, 6 und 8. Anmeldungen bitte bis 1.4. unter sekretariat.baer@hu-berlin.de
Bei Susanne Baer bedanke ich mich für die Offenheit, den bereichernden Austausch und die Bereitschaft, diese Lehrveranstaltung gemeinsam anzubieten. Wer sich für den breiteren Zusammenhang von Feminist Judgements und Re:Law interessiert, findet Hintergründe unter: Sußner / Westphal / Mehrens / Baer, 2025, Re:Law. Recht überdenken und neu gestalten, in: Forschungsgruppe Recht-Geschlecht-Kollektivität (Hrsg.): Recht umkämpft. Feministische Perspektiven auf ein neues Gemeinsames. Barbara Budrich [im Erscheinen; open access].
P. Sußner ist als Post Doc an der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität tätig. Sie leitet das von der Stiftung Innovation in der Hochschule, Freiraum 2023, geförderte Projekt Re:Law/lehre.