Christine Wimbauer und Mona Motakef beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Geschlecht, sozialer Ungleichheit und Anerkennung, mit Prekarität sowie den Folgen von prekärer Beschäftigung auf das gesamte Leben. Soeben erschien ihre Studie „Prekäre Arbeit, prekäre Liebe“ , die auf Interviews mit prekär Beschäftigten basiert. In ihrem Blogbeitrag argumentieren sie, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 zwar an sich nicht diskriminiert, aber die COVID-19-Pandemie bestehende soziale Ungleichheiten verschärft und neue schafft. Sie fordern daher eine Perspektive auf den gesamten vergeschlechtlichten Lebenszusammenhang und, um zukünftig weitere Spaltungen und Verwerfungen einzudämmen, eine Orientierung an Sorge und Solidarität.
Verletzbarkeit des Lebens – Prekarität des Sozialen
Die COVID-19-Pandemie führt derzeit die grundlegende Verletzbarkeit und Unsicherheit allen Lebens vor Augen. Im Angesicht des Virus sind wir alle prekär. Je nach Alter, körperlicher Verfassung, sozialem Status und nach Geschlecht betrifft uns COVID-19 aber unterschiedlich. Durch die Pandemie weiten sich bestehende Prekarisierungsprozesse und prekäre Lebenslagen aus. Aber schon vorher kam es mit dem sozialpolitischen Wandel („Hartz IV“) seit den 2000er Jahren in Deutschland zu einem Anstieg prekärer Beschäftigung. Bis jüngst waren in Deutschland 38 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse atypisch.
Durch die COVID-19-Pandemie bricht nun die Wirtschaftsleistung ein und die ohnehin bestehende Spaltung zwischen prekärer und sicherer Beschäftigung wird – trotz staatlicher Hilfen – vergrößert. Während manch gut bezahlte Wissensarbeiter*innen geschützt im Homeoffice sein können und einige wenige sogar das Privileg haben, dies als Entschleunigung zu erleben, verstärken sich die Unsicherheiten von prekär Beschäftigten. Auch diese sind heterogen: Seit Ausbruch der Pandemie melden viele Unternehmen Kurzarbeit an und/oder entlassen bereits Personal. Mit wenigen Ausnahmen wie Lebensmittelgeschäften sind im Einzelhandel die Läden geschlossen. Mittelfristig dürften viele Menschen ihre Arbeit verlieren. Für andere prekär Beschäftigte zeichnet sich eine Arbeitsverdichtung ab: Wer etwa Lebensmittel produziert und verkauft, wer unter Personalknappheit in Pflege- und Krankenhäusern arbeitet oder in anderen für die Daseinsvorsorge relevanten Organisationen, erfährt derzeit eine symbolische Anerkennung als „systemrelevant“. Unter prekären Bedingungen halten diese Beschäftigten – häufig Frauen – sprichwörtlich den Laden am Laufen. Prekär und unterbezahlt bleiben sie dennoch. Prekäre Beschäftigung wird zudem weiter nachgefragt und ausgebaut. Durch die weitreichenden Einreiseverbote sogar innerhalb der EU werden händeringend Erntehelfer*innen gesucht. In Zeiten, in denen Menschen zuhause bleiben müssen, übernehmen – ebenfalls unter prekären Bedingungen – wiederum Arbeiter*innen, die über digitale Plattformen wie Amazon und Deliveroo vermittelt werden, einen Großteil der Versorgung.
Prekäre Beschäftigung (und mehr noch Arbeitslosigkeit) haben aber nicht nur große ökonomische Ungleichheitsfolgen, zumal sie in der Regel mit geringen Einkommen verbunden sind, sondern bringen auch Anerkennungsdefizite in weiteren Bereichen mit sich. Prekäre Beschäftigung wirkt sich auch auf das Soziale aus: „Es löchert die Gesellschaft von innen raus auf“, so eine unserer Befragten. Prekarisierung betraf darüber hinaus auch schon vor COVID-19 das gesamte Leben: Soziale Beziehungen, Familie, Freundschaften, Paarbeziehungen, Liebe können prekär werden, die Sorge für sich und andere, die Gesundheit, soziale Teilhabe, Wohnraum, Sinn, die Zukunftsperspektiven und anderes mehr. Doch wie hängen Nahbeziehungen, Sorge und das gesamte Leben mit Ungleichheiten, Prekarität und Anerkennung zusammen?
Ungleichheiten, Prekarität und Anerkennung im Lebenszusammenhang
Unsere Gesellschaft ist strukturell hetero- und paarnormativ. Das Leben in einer (heterosexuellen) Paarbeziehung wird gesellschaftlich als das ‚richtige‘ und ‚glückliche Leben‘ vermittelt. Wie unsere Forschung zeigt, konnten für manche der Befragten Anerkennungsdefizite aus einer prekären Beschäftigung im Paar teilweise aufgefangen werden und traten so etwas in den Hintergrund. Oft bergen heterosexuelle Paarbeziehungen aber große Geschlechterungleichheiten und ungleiche Arbeitsteilungen. Sorgearbeit wird in der Regel Frauen zugewiesen, ist unsichtbar und wird kaum anerkannt. Viele der befragten Frauen litten emotional und körperlich unter der Mehrfachbelastung aus prekärer Beschäftigung, der nahezu alleinigen Sorgeverantwortung und der Hausarbeit. Im Paar entstanden Konflikte, und mehrere Frauen waren wegen Depression, Erschöpfung und Burn-out in Behandlung.
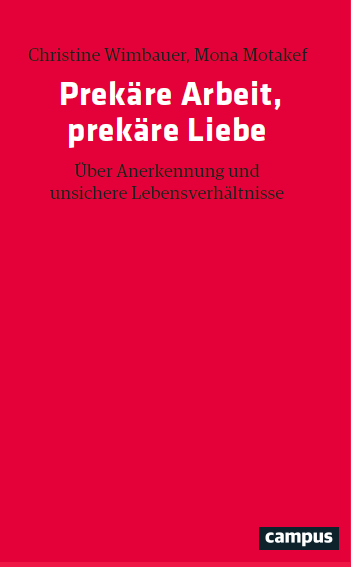
Wer nicht in einer Paarbeziehung lebt, ist zwar von Geschlechterungleichheiten im Paar kaum betroffen. Allerdings hat ein Leben ohne Partner*in in einer paarnormativen Gesellschaft oft große Ungleichheitsfolgen, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Alleinerziehende etwa haben das höchste Armutsrisiko. In unserer Studie deuteten es einige der Befragten als ihr Scheitern, dass sie keine Partnerschaft etablieren und keine Familie gründen konnten. Andere wiederum fanden zur romantischen Liebesbeziehung ansatzweise alternative Anerkennungs- und Sinnquellen, etwa in Freundschaften oder einer Orientierung an Familie und Kindern. Was wir aber nicht fanden, waren zur Erwerbsarbeit alternative Anerkennungsquellen.
Während (die befragten) Frauen weiterhin die Hauptverantwortung für Sorge und Haushalt trugen, wurde von Männern – im Paar, in der Erwerbssphäre, sozialstaatlich – weiter erwartet, dass sie die Rolle des Familienernährers ausfüllen. Auch wenn Väter sich stärker um ihre Kinder kümmern wollten, erhielten sie dafür auf den verschiedenen Ebenen nur sehr begrenzt Anerkennung. Für sie bestehen ähnliche Vereinbarkeitskonflikte und Hürden wie für Mütter; alleinerziehende Väter stießen angesichts ihrer Sorgeorientierung etwa bei der an Vollzeit orientierten Arbeitsvermittlung auf größere Schwierigkeiten.
Die COVID-19-Pandemie legt zudem die enge Verbindung von Nahbeziehungen, Geschlecht und Ungleichheiten offen: Da derzeit Schulen und KiTas geschlossen sind, kompensieren weiterhin vor allem Frauen den Mehraufwand in der Betreuung inklusive Home Schooling und Hausarbeit. Da für Alleinerziehende Unterstützungsnetzwerke wegfallen, ist für sie die gebotene Isolation eine enorme Herausforderung. Der Verlust der Ernährerrolle, finanzielle Sorgen, das Gefühl eingesperrt zu sein und enger Wohnraum ohne Rückzugsmöglichkeit stellen schließlich Faktoren dar, die häusliche Gewalt, die häufiger von Männern ausgeübt wird, begünstigen und Kinder und Frauen besonders gefährden.
Politiken der Ent_Prekarisierung, Sorge und Solidarität
Wie durch ein Brennglas verschärfen sich also derzeit Ungleichheiten, die auch schon vor der Pandemie bekannt waren, und neue entstehen. Wir sollten ihnen mit umfassenden Politiken der Ent_Prekarisierung begegnen (siehe Wimbauer/Motakef 2020, Kapitel 13). Diese nehmen in der Verletzbarkeit des Lebens ihren Ausgangspunkt. Sie dezentrieren Erwerbsarbeit und stellen – so eine alte, doch ungebrochen aktuelle feministische Forderung – Sorge und den gesamten Lebenszusammenhang ins Zentrum. Wir plädieren für eine Entprekarisierung von Beschäftigung, eine Orientierung an Guter Arbeit, für eine 32- oder 35-Wochenstunden-Vollzeitvorstellung und die Etablierung von kreativen Lebensarbeitszeitenmodellen. Prekär Beschäftigte sollten besser bezahlt und abgesichert werden, so dass die bisher nur symbolische Anerkennung der Notwendigkeit und ‚Systemrelevanz‘ ihrer Arbeit auch materiell eingelöst wird. Diese Entprekarisierung müsste mit einer grundlegenden sozialen Sicherung und Daseinsvorsorge unabhängig vom Markt und der sogenannten Leistungsfähigkeit auf dem Markt einhergehen. Darüber hinaus bedarf es einer Prekarisierung von Geschlechternormen, die Geschlechterungleichheiten verfestigen und Lebensentwürfe einengen. Es wäre weiter zu fragen, wie Lebensformen, Verantwortungs- und Solidargemeinschaften abgesichert werden können, die von der Paarbeziehung und der klassischen Kernfamilie abweichen. Solidarität ist in Zeiten ausgeweiteter Verletzbarkeit wichtiger denn je – auch über nationale Grenzen hinweg. Wenn auch körperlich auf Abstand und isoliert, so können wir es doch nur gemeinsam durch diese prekären Zeiten schaffen.
Wimbauer, Christine und Mona Motakef (2020): Prekäre Arbeit – prekäre Anerkennung? Eine Studie über unsichere Lebensverhältnisse. Frankfurt/New York: Campus (open access)
Christine Wimbauer ist Professorin für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse an der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Geschlechterforschung, Soziologie der Arbeit (Erwerbs- und Sorgearbeit; u.a. Prekarisierung), Soziologie sozialer Ungleichheit, Soziologie der Paar- und Nahbeziehungen, Liebe und Familien jenseits der Heteronorm, Sozialstrukturanalyse, Sozial- und Familienpolitik, Anerkennungstheorie, qualitative Methoden der Sozialforschung. Sie ist u.a. Autorin von „Wenn Arbeit Liebe ersetzt“ (2012, Campus), „Das Paarinterview“ (2017, Springer VS, mit Mona Motakef), „Prekäre Arbeit, prekäre Liebe. Über Anerkennung und unsichere Lebensverhältnisse (2020, Campus, mit Mona Motakef) und „Future Love. Co-Parenting und die Zukunft der Liebe“ (erscheint Anfang 2021) .
Mona Motakef ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrbereich Arbeit und Geschlechterverhältnisse am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, den sie im Wintersemester 2019/2020 als Gastprofessorin vertrat. Für ihre Forschung im DFG-Projekt „Ungleiche Anerkennung? ‚Arbeit‘ und ‚Liebe‘ im Lebenszusammenhang prekär Beschäftigter“ (Leitung: Prof. Dr. Christine Wimbauer) erhielt sie 2018 den Maria-Weber-Grant für Habilitanden der Hans-Böckler-Stiftung. Arbeitsschwerpunkte: Geschlechtersoziologie, Soziologie der Arbeit (insbes. Prekarisierung von Erwerbs- und Sorgearbeit), soziale Ungleichheit, Soziologie der Paar- und Nahbeziehungen, Soziologie der Körper und der Technik und qualitative Methoden der Sozialforschung. Sie ist u.a. Autorin von „Prekarisierung“ (2015, transcript), „Das Paarinterview“ (2017, Springer VS, mit Christine Wimbauer), „Recognition and precarity of life arrangement. Towards an enlarged understanding“ Distinktion. Journal of Social Theory 20 (2) und „Prekäre Arbeit, prekäre Liebe. Über Anerkennung und unsichere Lebensverhältnisse“ (2020, Campus, mit Christine Wimbauer).
